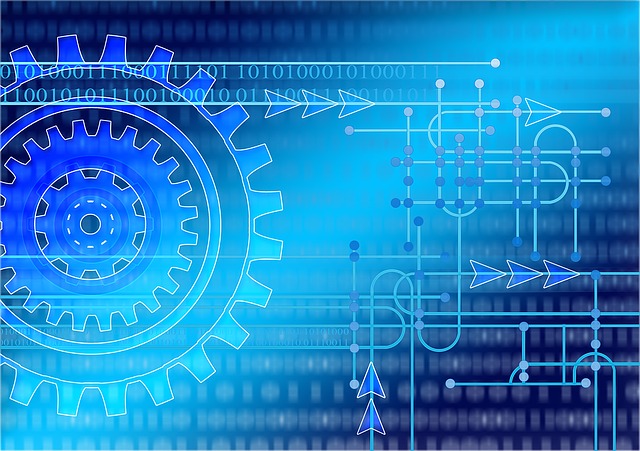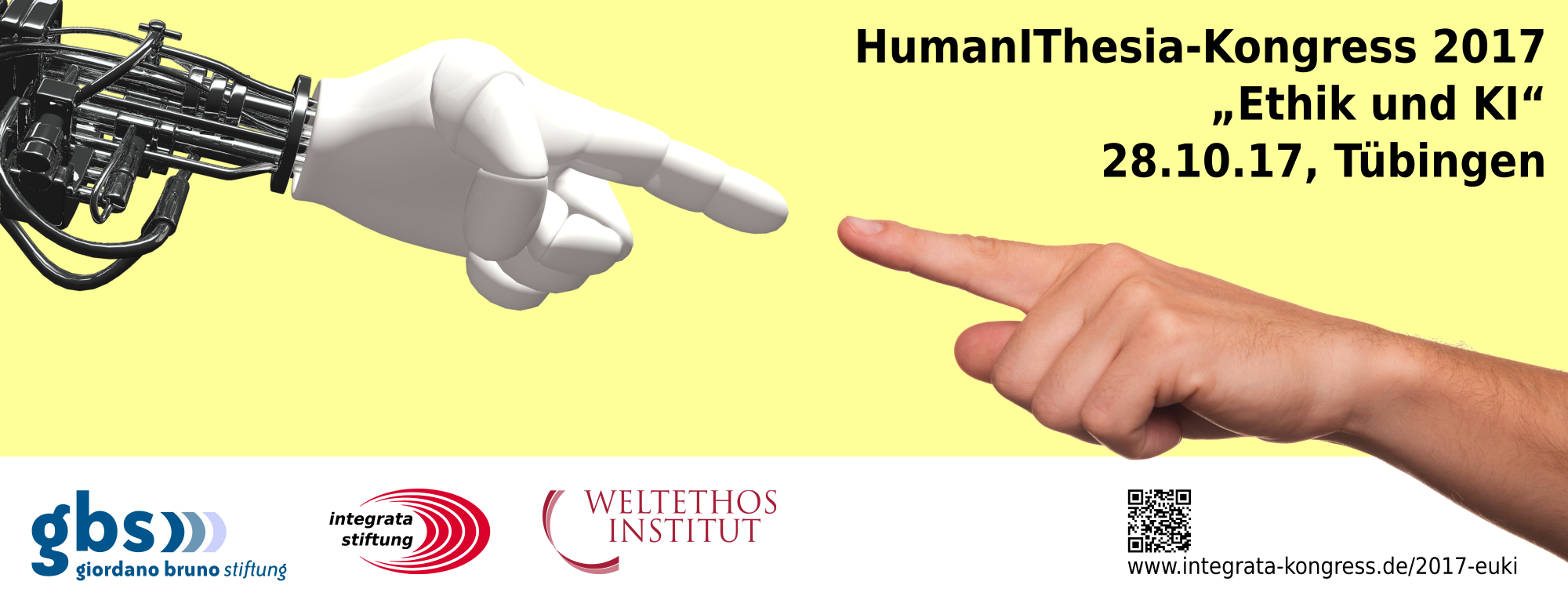Humanithesia im Augustinum Stuttgart
Das Humanithesia-Team tourt auch im Jahr 2018 durch das Land, um über ethische Herausforderungen bei künstlicher Intelligenz zu sprechen. In der vergangenen Woche war der Vorstand der Tübinger Integrata-Stiftung, Michael Mörike, im Stuttgarter Augustinum, um mit Senioren zu diskutieren – und Regeln für den Einsatz und zur Realisierung von Robotern und KI anzuregen. Die Präsentation von Michael Mörike können Sie sich hier herunterladen. Wenn Sie auch mit uns diskutieren wollen: Unsere nächste Veranstaltung ist der Workshop „Wie muss Technik?“ im März in Berlin. Weiterführende Links: Vortrag von Michael Mörike [PDF] Workshop „Wie muss Technik“?